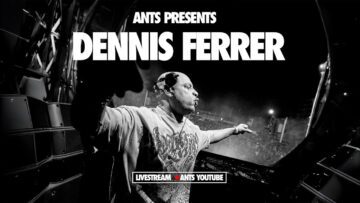Konservierte Ekstase: Warum das Omen im Museum wie ein ausgestopftes Raubtier wirkt
Man muss schon eine gehörige Portion kognitiver Dissonanz mitbringen, um die beißende Ironie dieser Situation nicht zu spüren. Wer heute im Frankfurter Museum of Modern Electronic Music (MOMEM) an der Hauptwache die Geschichte des „Omen“ studieren will, zahlt Eintritt, wandelt durch klimatisiertes Ambiente und betrachtet den Rausch hinter Sicherheitsglas. Vor dreißig Jahren, kaum einen Steinwurf entfernt in der Junghofstraße, war der Eintrittspreis kein Ticket für die Kulturgeschichte, sondern der Obolus für den völligen Kontrollverlust. Die Luft war dort keine kuratierte Museumsatmosphäre, sondern ein chemisches Gemisch aus Schweiß, Nebelfluid und Poppers, und das einzige Glas waren die Scherben einer Nacht, die sich weigerte, Tag zu werden.
Strobo, Bass, Schweißtropfen: Das "Omen" kehrt zurück nach Frankfurt






Wir leben in einer Ära der zwanghaften Archivierung. Alles, was einst wild, unberechenbar und gefährlich war, wird heute dokumentiert, kuratiert und damit unschädlich gemacht. Die aktuelle Ausstellung wirft dabei eine Frage auf, die weit über das sentimentale Seufzen alternder Raver hinausgeht: Lässt sich der Geist eines Ortes, dessen Daseinszweck das Verschwinden im „Jetzt“ war, überhaupt musealisieren, ohne ihn zu ersticken? Oder betrachten wir hier schlicht einen hochpolierten Sarkophag?
Der Sound der Leistungsgesellschaft
Um das Phänomen „Omen“ wirklich zu begreifen, darf man sich nicht von den bunten Flyern in den Vitrinen blenden lassen. Man muss auf die Stadt blicken, die diesen Druckkessel physikalisch nötig machte. Wer das Frankfurt der späten Achtziger und Neunziger analysiert, sieht kein Biotop für Träumer. Es war eine Stadt der harten Brüche und der kalten Fassaden. Hier die gläsernen Phalli des Finanzkapitals, dort die US-GIs, die über die Airbase und den Flughafen nicht nur Truppen, sondern auch Vinyl aus Chicago und Detroit in die Stadt pumpten.
Es ist eine oft übersehene Wahrheit: Der „Sound of Frankfurt“ klang deshalb so, wie er klang – härter, industrieller, gnadenloser als das verspielte, fast hippieeske Berliner Pendant –, weil er der Herzschlag einer Stadt war, die nicht schlief, sondern arbeitete. Die BPM-Zahl (Beats per Minute) korrelierte direkt mit dem Ticker der Börse. Techno in Frankfurt war kein hedonistischer Ausstieg, sondern die akustische Fortsetzung der Leistungsgesellschaft mit anderen Mitteln.

Als Sven Väth, Michael Münzing und Mathias Martinsohn 1988 den ehemaligen Schicki-Micki-Laden „Vogue“ übernahmen, vollzogen sie keinen bloßen Besitzerwechsel. Sie begingen einen ästhetischen Vatermord.
Ein Experte:
Viele glauben, der Erfolg des Omen basierte auf einer ausgeklügelten Lichtanlage oder teurem Design. Das Gegenteil ist der Fall. Die radikalste Innovation war die Negation des Visuellen. In einer Zeit, in der Diskotheken Orte des „Sehens und Gesehenwerdens“ waren, strichen die Macher den Laden schwarz, rissen die Spiegel heraus und installierten Stroboskope, die keine Orientierung boten, sondern sie zerstörten. Das Omen war eine Maschine zur Desorientierung. Wer nichts mehr sieht, muss fühlen. Der Bass war nicht nur Musik, er war die Architektur des Raumes.
Die Lüge vom sauberen Rausch
Die Ausstellung im MOMEM versucht, diese Maschinerie mittels Exponaten zu rekonstruieren. Das ist handwerklich solide, verfehlt aber zwangsläufig den Kern. Denn ein Club ist kein visuelles, sondern ein physisches Ereignis. Er besteht aus Hitze, aus Kondenswasser, das von der Decke tropft – dem sogenannten „Raver-Regen“ –, und aus Frequenzen, die den Brustkorb als Resonanzkörper missbrauchen.
Und machen wir uns nichts vor: Zur historischen Wahrheit gehört die chemische Beschleunigung. Ecstasy war nicht das Beiwerk, es war der Treibstoff. Zehn Jahre lang diktierte dieser Ort den Biorhythmus einer ganzen Generation. Das Omen etablierte etwas, das heute Standard, damals aber revolutionär war: Das Wochenende nicht als Abfolge von Tagen, sondern als einen einzigen, nahtlosen Bewusstseinsstrom.
Wer Freitagabend in den Keller hinabstieg und Montagvormittag wieder ausgespuckt wurde, hatte eine Metamorphose hinter sich. Der Investmentbanker tanzte neben dem Arbeitslosen, der Hetero neben dem Queer. Diese Egalität war aber kein politisches Programm, wie es uns Kulturwissenschaftler heute gerne einreden wollen. Sie war schlicht die physiologische Folge des Rausches. Serotonin kennt keine Steuerklassen. In einer streng hierarchischen Gesellschaft bot die Nacht die einzige, wenn auch temporäre, soziale Amnestie.
Das Museum als Feigenblatt der Verdrängung
Dass diese Geschichte nun im Museum landet, mag man als späte Ehre empfinden. Techno ist der einzige relevante kulturelle Exportartikel der deutschen Einheit, und Frankfurt lieferte die Blaupause. Doch der Applaus bleibt mir im Halse stecken. Denn die Musealisierung des „Omen“ ist in Wahrheit eine Bankrotterklärung der Stadtplanung.

Das Gebäude in der Junghofstraße wurde längst abgerissen, heute steht dort gesichtslose Büroarchitektur. Die Rendite hat den Rausch verdrängt. Unsere Innenstädte sind zu optimierten Konsumzonen verkommen, in denen Lärmschutzverordnungen und Gentrifizierung genau jene Subkultur ersticken, mit deren Image das Stadtmarketing so gerne hausieren geht. Wir bauen Mausoleen für den Exzess, weil wir den lebendigen Exzess in unserer durchgetakteten Realität nicht mehr dulden. Wir betrachten das Feuer hinter Sicherheitsglas, weil wir panische Angst haben, uns die Finger zu verbrennen. Das MOMEM ist in diesem Sinne kein Ort der Erinnerung, sondern ein Ort der Trauerarbeit für eine Stadt, die ihre eigene Wildheit verkauft hat.
Fazit: Der Tod des Mysteriums durch das Selfie
Was uns beim Gang durch diese Ausstellung schmerzhaft bewusst wird, ist nicht nur der Verlust eines Ortes, sondern der Verlust eines Zustandes. Das „Omen“ funktionierte, weil es ein Schutzraum vor der Außenwelt war – ein analoges schwarzes Loch.
Heute, in der Ära der totalen digitalen Sichtbarkeit, ist dieser Zustand unmöglich geworden. Wenn jeder Moment auf Instagram dokumentiert werden muss, kann kein Kontrollverlust mehr stattfinden. Das Omen im Museum lehrt uns eine bittere Lektion über unsere Zukunft: Wir haben die Dunkelheit gegen 4K-Auflösung getauscht und das Mysterium gegen Information. Wir wissen heute alles über die Party, aber wir fühlen sie nicht mehr. Die Vitrinen sind voll, das Gedächtnis ist archiviert, aber die menschliche Seele verhungert vor dem hell erleuchteten Display. Der wahre Geist des Omen lässt sich nicht ausstellen – er lässt sich nur vermissen.
Quellen der Inspiration
MOMEM Frankfurt | Offizielle Seite der Ausstellung und des Museums | momem.org
FAZ Feuilleton | Artikel zur Geschichte des Omen und der Schließung 1998 | faz.net
Groove Magazin | Chronik der elektronischen Musik und Sven Väths Einfluss | groove.de
Das Filter | Interview mit Michael Münzing über die Anfänge | dasfilter.com









![[Tape 070] Loveparade 2003-12 Tobi Neumann – Naughty [side A]](https://technostreams.de/wp-content/smush-webp/2026/02/1771430468_hqdefault-360x203.jpg.webp)